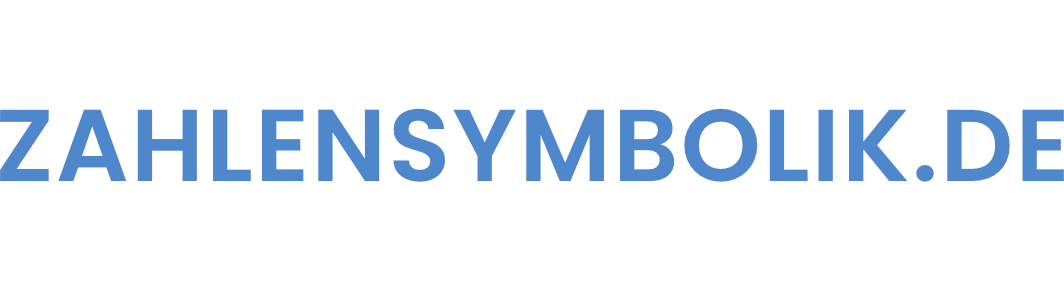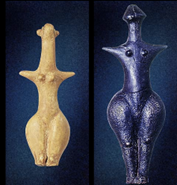Die mysteriösen Koran-Initialen und das polare Wesen der Zahlen
Die mysteriösen Koran-Initialen und das polare Wesen der Zahlen von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Die Herausforderung Koran-Initialen sind Vorbuchstaben bzw. Vorzahlen, die 29 der 114