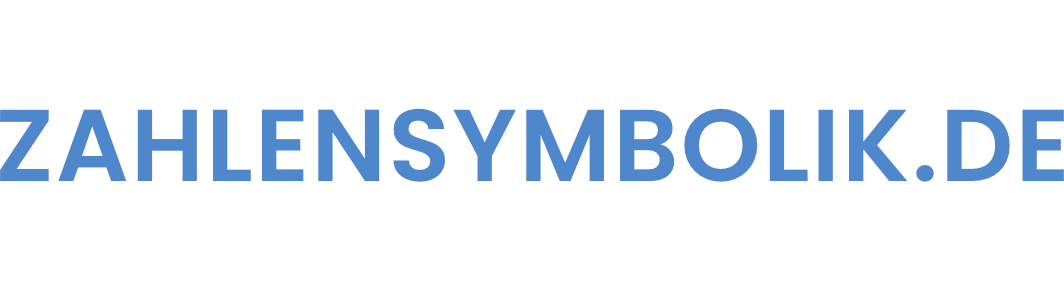Die im Periodensystem der Elemente zu beobachtende Ausrichtung der Substanzen ist das Samenkorn für die später entstehende Moral der Subjekte. Der substantielle Drang, die Achtzahl von Elektronen zu erreichen, entspricht dem Begehren der Subjekte nach Sinn und Achtsamkeit. Dazu muss die Substanz ausgerichtet und orientiert werden. Aus der unbedeutenden „Erde“ (#r,a / 1-200-90) muss „Ackerboden“ (Mda / adama / 1-4-40) werden. Die im biblischen Begriff des Acker- oder Erdbodens enthaltene Zuschreibung des Bodens bindet die Subjekte an den Geist der Einheit, den er in allen ihren Manifestationen wiedererkennt. Indem der Mensch (Mda / Adam / 1-4-40) einen Stein zum Menhir aufrichtet, eine Stehle errichtet oder ein Grabmal oder Monument erschafft, entsteht ein Kristallisationspunkt für die Zugehörigkeit der Subjekte. Ihr Dasein bekommt eine Spur. Die sinnhinterlegten Substanzen führen zu Stabilität und Halt im unvermeidlichen Begehren der Subjekte nach Bestand. Über die ausgerichtete und zugeschriebene Substanz wird die bis dahin verborgen gebliebene aber stets wirkmächtige, einheitsstiftende Kraft sichtbar. Die Substanz wird zum Materialisationspunkt von Gruppen, die durch ihre definierte Zugehörigkeit Stabilität erzeugen, von der ihrerseits eine Dynamik ausgeht. Die Stabilität ist geistiger Natur (s. Dreieck III). Sie verhilft dem Subjekt, sich nicht im Endlosen und Grenzenlosen zu verlieren.
Das Grabmal, der Stein, der Pfahl oder die Stele wirken aus dem Vergangenem heraus im Hier und Jetzt. Sie verbinden die Generationen. Sie sind ein Sammelort, verbinden die voneinander unterschiedenen Dimensionen und übermitteln Sinn. Die bewusste, dimensionsübergreifende Ausrichtung von Substanz setzt einen Gegenpol zu der in der linearen Sicht drohenden Entropie.
Werden die das Lineare definierenden Punkte Anfang und Ende oder Null und Unendlichkeit nicht bewusst der alles umgreifenden Ganzheit zugeordnet, entsteht Furchtbares. Dann führen das Nichts und der Tod in die Enge und erzeugen Angst. Wenn der Tod umbenannt wird in „Lebensende“, dann verlieren die Gräber ihre Funktion. Das führt dann zu der Vorstellung, dass die Seelen der Toten umherirren und die Lebenden bedrohen. Grab- und Denkmäler leugnen den Tod nicht, sie bekräftigt ihn. Sie materialisieren das Abwesende und geben ihm Sinn.
Kultur leugnet die Trennung (2) nicht. Sie funktionalisiert (23) sie und ordnet sie zu. Diese neu gesehene Trennung (2) macht Stabilität (1) spürbar. Das ewig Währende wird vom Vergänglichen getrennt und Ersteres bewahrt. Daran richtet sich das Individuum auf. Die Ausrichtung „nach oben“ geschieht eindrucksvoll im Zarathustra-Kult, der in der Spitze seiner Schweigtürme das Skelett vom Fleisch trennt, um danach das Skelett aufzubewahren.
Die aus einer Kultur entstehende Sicherheit basiert auf mehr als nur auf Konstanz im Sinne des Unveränderlichen. Eine Kultur verbindet das Einst mit dem Jetzt und schließt darin Veränderung ein. Kultur ist eine im Fluss der Dinge immer aufs Neue sichtbar werdende Kontinuität. Wer einer Kultur bewusst angehört, der ist orientiert und „hält Kurs“. Er folgt dem generationsübergreifenden roten Faden eines Ganzen.
Kultur beruht auf triadischem Denken. Das meint „Am Anfang war das Wort“ (Joh 1,1), das eigentlich direkt mit dem originalen Begriff des „Logos“ oder mit „Gesetz“ übersetzt werden müsste. Rein lineares Denken hingegen, wie es die profane Kulturhistorie pflegt, zerstört Kultur. Die Kulturhistorie reicht mit ihrer Elle bis 100.000 v.Chr. zurück, denn so alt sind die ersten uns bekannten Bestattungsriten. Die ersten Knochen, die nicht nur liegengelassen oder weggeworfen sondern säuberlich neben einander angeordnet worden waren, sind noch älter. Aus dieser linearen Sicht verliert sich das Johanneswort vom Logos. An seine Stelle setzt beispielsweise Regis Debray die Aussage „Am Anfang war der Knochen“.¹ Dass auch die ersten geordneten Knochen Sinn und Ordnung bekunden, reicht nicht aus, um den ihr zugrundeliegenden, ewigen Logos zu erfassen. Der Schlüssel zu ihm findet sich immer in der augenblicklichen Kultur. Wäre das nicht so, so würde es ihn nicht geben.
Dass aber die Religion die Moral erst hervorgebracht hat, ist ebenso eine Halbwahrheit, denn Moral ist älter als Religion. Sie ist genetisch angelegt und wir finden ihren Grund schon in den Archetypen. Das muss der Ordnung nach so sein und die Wissenschaft muss dies spätestens akzeptieren seitdem wir die Forschungsergebnisse des niederländischen Tier- und Verhaltensforschers Frans de Waal kennen (The Bonobo and the Atheist, USA). Moralisches Verhalten ist bei Primaten biologisch vorprogrammiert, existiert also schon lange, bevor die Religion auftauchte. Die Religion aber erhebt uns noch einmal weit über sie und sie sollte deshalb auch unser höchstes Forschungsgut sein. Die Menschen werden nicht etwa von der Religion bedroht – im Gegenteil. Sie werden bedroht vom Dogmatismus und der existiert auch gegen die Religionen.